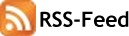Kleine Wasserkraftwerke, offiziell als Kleinwasserkraft bezeichnet, können ein wichtiger Faktor zum Gelingen der Energiewende und zur Stabilisierung örtlicher Stromnetze darstellen. Ökologische Bedenken können durch moderne Auslegung, z.B. Fischtreppen, entkräftet werden.
Ich kenne es noch aus meiner Jugend in den 60er Jahren: An Bachläufen, die ganzjährig Wasser führten, gab es noch Mühlen. Nicht selten lief dort ein Stromgenerator mit, der aus dem fließenden Wasser Strom für die Mühle oder die umliegenden Häuser des Dorfes lieferte. Dann kamen die Bachbegradigungen und viele Mühlen waren nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.
Big ist beautiful hieß es, außer großen Kraftwerken an Staustufen oder Speicherseen wurden diese Kleinwasserkraftwerke zur Stromerzeugung abgeschaltet. Zudem hieß es aus Umweltschutzgründen: "Wir wollen nicht mehr, dass Bachläufe an einem Wehr gestaut werden, um einen kleinen Generator anzutreiben. Die Fische können dann nicht mehr die Flüsse oder Bäche hinauf, zu den Laichgebieten wandern." Das war der Tod der Kleinwasserkraft.
Was ist eigentlich Kleinwasserkraft?
Der Begriff Kleinwasserkraft ist der Sammelbegriff für die Nutzung der hydraulischen Energie fließender Gewässer (Flüsse, Bäche). In Deutschland wird die obere Grenze der Stromerzeugung durch Kleinwasserkraftwerke bei ca. 1 MW angegeben. In anderen Ländern Europas werden Anlagen bis 10 MW Leistung als Kleinwasserkraftwerke bezeichnet.
Beitrag zur Energiewende durch Kleinwasserkraft
Die meisten dieser kleinen Wasserkraftwerke stehen noch an kleinen Flüssen oder größeren Bächen. Meist wird dann das Wasser über ein Wehr zu den Turbinen geleitet. In Flüssen sitzen die Turbinen meist an Staustufen.
Die kleinste Form eines Kleinwasserkraftwerks ist zurzeit das Wasserwirbelkraftwerk. Bei diesem Typ wird einem fließenden Gewässer mit Hilfe einer kurzen Betonrampe Wasser abgezweigt und einem kreisrunden Betonbecken mit Abfluss zugeführt. Der dabei entstehende Wasserwirbel treibt einen speziell geformten Wirbelrotor an, der durch die entstehende Drehkraft Strom erzeugt. Der verlinkte Wikipedia-Artikel enthält eine umfangreiche Beschreibung der Technik.
Viele Kleinwasserkraftwerke können einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und die lokalen Stromnetze stabilisieren. In Österreich waren 2022 laut Wikipedia noch 4000 Kleinwasserkraftwerke in Betrieb. Diese lieferten 6 Terawattstunden Strom im Jahr – und vor allem in den Wintermonaten führen Flüsse viel Wasser, während Solaranlagen eher im Sommer für die nachhaltige Stromerzeugung sorgen.
Ich bin kürzlich in den vdi Nachrichten auf einen entsprechenden Beitrag gestoßen (leider nur mit Registrierung lesbar, hier eine Variante des Beitrags frei abrufbar). Dort fand sich die Information, dass in Bayern noch rund 4200 Laufwasser- und Speicherkraftwerke (von ehemals 12.000) existieren. Als Beispiel wird das Familienunternehmen E-Werk Schweiger im bayerischen Schwaig genannt. Dieses betreibt fünf Wasserkraftwerke, die mit Francis- bzw. Kaplan-Turbinen zusammen rund 5 Mio. kWh pro Jahr erzeugen und mehr als 1500 Haushalte versorgen.
Manche dieser Anlagen laufen seit 70 bis 80 Jahren und länger immer noch einwandfrei – eine sehr nachhaltige Lösung. Inzwischen gibt es Überlegungen in Bayern, wie man die noch vorhandenen 4200 Kleinwasserkraftwerke in die lokale Stromversorgung zur Stabilisierung einbinden kann. Das Familienunternehmen E-Werk Schweiger hat bereits vor Jahren ein Notstromkonzept realisiert. Sollte es in der Gemeinde Schwaig zu einem großflächigen Blackout kommen, bleiben das Rathaus, die Feuerwehr, die Polizei, die Arztpraxen, die Apotheken, die Straßenbeleuchtung und die Pumpstationen funktionsfähig. Welche Einrichtungen zur kritischen Infrastruktur gehören, bestimmt die Gemeindeverwaltung.
Umweltschutz steht Kleinwasserkraft entgegen
In Bayern gibt es über 56.000 Wehre und Querbauten, die als Hochwasserschutz, wegen der Grundwasserstabilisierung, der Flussbegradigung oder Flurbereinigung errichtet wurden – ohne Energie zu produzieren.
In Kreisen von Umweltschützern ist Kleinwasserkraft nicht gerne gesehen – die Wehre seien am Arten- und Fischsterben schuld, heißt es. Umweltorganisationen wie auch Wassersportler möchten auch Altanlagen abreißen und die Gewässer renaturieren.
Die Wasserkraft-Verbände plädieren dagegen dafür, vorhandene Wehre zur Stromgewinnung zu nutzen, wo es ökologisch verträglich ist, und sie dabei durchlässig für Fische und Kleinlebewesen zu machen. Fischtreppen bieten den Tieren die Möglichkeit, stromaufwärts zu wandern, um dort zu laichen.
Am Fisch- und Artensterben seien vor allem die Schadstoffe in den Flüssen und Bächen und die höheren Temperaturen schuld, argumentieren die Wasserkraft-Verbände. Die Wehre hinderten dagegen die Ausbreitung invasiver Arten wie des Signalkrebses und schützten oft Ortschaften vor Überschwemmungen. "Wir können durch Vorfluter das Wasser des Flusses Dorfen ableiten und stehen auch mal nachts auf, um die Schleusen zu öffnen.", zitieren die vdi Nachrichten einen Betreiber.